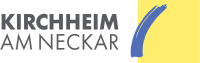Geschichtsverein | 30.06.2025
Die Bundschuh-Erhebungen

Der Begriff Bundschuh bezeichnet einen historischen Lederschuh, der mit einem langen Riemen gebunden wurde. Im Mittelalter wurde er vor allem von der Landbevölkerung getragen – im Gegensatz zu den teuren Schnallenschuhen der städtischen Bürger.
Im Vorfeld des Deutschen Bauernkriegs wurde der Bundschuh zu Anfang des 16. Jahrhunderts zu einem Gemeinschaftssymbol der Bauern und der Bundschuh-Bewegung, wie die aufständischen Bauern in den Jahren 1493 bis 1517 in Südwestdeutschland genannt wurden. Sie war eine der Wurzeln des deutschen Bauernkriegs von 1524 bis 1526. Die Bundschuh-Bewegung war jedoch keine organisierte Bewegung im eigentlichen Sinne, sondern bestand aus mehreren regionalen Aufständen gegen Unterdrückung und Leibeigenschaft.
Im Vorfeld der Bundschuh-Bewegung rief im Frühjahr 1476 Hans Böhmin, ein bis dahin unbedeutender Viehhirte, die Menschen zur Wallfahrt nach Niklashausen auf. Er versprach den Wallfahrern im Namen der Jungfrau Maria vollkommenen Ablass von ihren Sünden, verkündete die soziale Gleichheit der Menschen, Gemeineigentum und Gottes Strafgericht über die Eitelkeit und unersättliche Gier der Fürsten und hohen Geistlichkeit.
Seine Predigten trafen die Seelenlage des Volkes. Man verehrte ihn als „heiligen Jüngling“ und „Propheten“. In nur drei Monaten soll er mehr als 70.000 Anhänger gewonnen haben. Die Obrigkeit verfolgte dies mit großer Sorge. Der Würzburger Fürstbischof ließ Hans Böhm verhaften. Wegen seiner Gefangennahme kam es unter der fränkischen Landbevölkerung zu einem kurzzeitigen, spontanen Massenprotest. Im Schnellverfahren als Ketzer zum Tode verurteilt, wurde er am 19. Juli 1476 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Weitere Artikel:
- Die Bundschuh-Erhebungen
- Der „Arme Konrad“ in Kirchheim